Von einem der auszog, um ein RYA Day Skipper zu werden. Ein Bericht aus Segelleben auf hoher kanarischer See

Segeln gilt ja gemeinhin als ein eher komplexer Zeitvertreib. Nicht völlig zu unrecht. Umso besser ist es, wenn man einen wie Bernhard Hofer an Bord hat, der diese Komplexität etwas zu reduzieren vermag. „Geht sich des aus?“ fragt er uns, immer wieder. Also zum Beispiel wenn wir mit 48 Fuß rückwärts in die Boxengasse einparken, hektisch wenden, um eine Boje namens Dan zu retten oder einfach unter Segeln ankern, um hernach versonnen bis sinnierend in den Sonnenuntergang zu blicken. Zufrieden ist man in aller Regel bereit mit einem „Passd scho’“, glücklich aber ist man, wenn es am Ende heißt: „Des geht sich eh aus!“

In aller Herrgotts*frühe bin ich an diesem Neujahrsmorgen in ein Hochrisikogebiet mitten auf dem Atlantik aufgebrochen, um ein RYA Day Skipper zu werden. All das hatte ja schon im letzten Jahr zu selben Zeit stattfinden sollen, fiel dann aber ja dieser Pandemie zum Opfer. In der Zwischenzeit hatte ich mir schon mal einen 24 Fuß großen Kleinkreuzer gegönnt, einen GfK-Klassiker aus der Vierteltonner-Ära, und ihn mit Hilfe meines Segelmentors Matthias Beilken von der Elbe auf die Weser verlegt, um ihn dort auf dem Gezeitenfluss das Jahr über auf und ab zu segeln. Ob das reichen würde, um ein zertifizierter RYA Day Skipper zu werden?

Nun ja. Wenn man die Tiden an der norddeutschen Küste gewöhnt ist, dann sind jene auf den Kanaren schon eher zu vernachlässigen. „What is the king factor“? fragt uns Bernhard vor dem Ablegen und hier jedenfalls ist es immer der meist aus Nordost wehende Wind, nie der Strom der Gezeiten. Sie sind – in Wahrheit – sogar fast zu vernachlässigen: In diesem Revier richtet niemand seine Törnplanung danach aus und schon gar nicht sieht man sich genötigt, wegen des Tidenkalenders schon morgens um halb sechs aufzubrechen, um an sein Ziel zu gelangen, ohne kurz vor Ende, aber nach dem Tidenkipp träge gegenan segeln zu müssen. Das ist auf der Nordsee bekanntlich anders.

Meine Herausforderungen hier sind also andere. Boat Handling auf engen Raum gehört dazu, denn ich bin das, was Bernhard ein „Pinnenkind“ nennt, Doppelsteuerstände in Carbonoptik sind mir bis dato fremd. Und wenn man sonst vor allem siehe oben segelt, ist eine Sun Odysee 479 mit ihren 48 Füßen doppelt so groß, gefühlt aber drei Mal so groß und auch drei mal so träge wie das, was ich halt so gewohnt bin. Segeln lernt man auf der Jolle? Beim rückwärts Einparken in die Boxengasse einer Marina beschleichen mich leise Zweifel an dieser Weisheit. Mein Bootsgefühl ist doch ein anderes. Ein viel direkteres. Aber vielleicht bin ich ja auch hier, um Gelassenheit zu lernen? Gut aber, dass ich gleich zwei Wochen da bin und in Phase II eine Dufour 382 Grand Large wartet, mit übersichtlicheren Elfmeterirgendwas. Um am Ende werde sogar ich es, dank zahlreicher geduldiger Übungseinheiten von Skipper & Crew und trotz aller Widerstände der Marineros da wie dort hinbekommen haben.

Anders als bei den Yachtmaster-Zertifikaten der RYA endet die Ausbildung des Day Skippers, der einem immerhin bescheinigt, man könne eine Yacht am Tag in vertrauten Gewässern verantwortlich segeln, nicht mit einer Prüfung. Das hat Vorteile, insbesondere wenn man zu Prüfungsangst neigt, aber den Nachteil, dass ich mich irgendwie immer beobachtet und begutachtet fühle, weil ja am Ende das wohlwollend-kritische Feedback kommen wird, das man heute „Debriefing“ nennt. Zugleich sende auch ich natürlich lauter Bilder von Sonnenuntergängen in die graue, nebelverhangene Heimat und rufe dort damit bisweilen etwas Neid hervor. Doch für mich fühlt sich das meist nicht wie Urlaub an, so sehr man regenfreie 20 Grad, T-Shirts, kurze Hosen und das Baden in Ankerbuchten im Januar zu schätzen weiß. „Anderen geht es noch viel schlechter“ wird in der Crew der zweiten Ausbildungswoche zum geflügelten Wort werden. Man kann nicht klagen.

Trotzdem steht auch bei uns Sunset-Sailing im Logbuch, nicht ohne zuvor und reihum allerlei Ankermanöver geübt zu haben, die auch mir etwas die Scheu davor nehmen werden. Wir spüren aber auch, dass diese Ankerromantik ihre Grenzen hat: Als wir in der Papageienbucht liegen, und der Wind von der einen, der Schwell aber von der anderen Richtung kommt, schaukelt uns die „Tortuga“ nachts aus dem Schlaf, bis frühmorgens, weit vor Sonnenaufgang, das aus Faulheit ungespülte Weißweinglas klirrend zu Boden fällt und einen jeden an Bord weckt, der vielleicht doch geschlafen haben sollte. Gut, dass die böse Pharmaindustrie für Menschen wie mich Tabletten erfunden hat, wahlweise auch solche, die gegen Anflüge von Seekrankheit helfen, einen aber trotzdem nicht in den Schlaf zwingen, wenn man das gerade mal nicht will (sondern steuern).

Und, Day Skipper hin oder her, auch wir sind immer wieder mal nachts unterwegs – ohne diese neumodischen elektronischen Seekarten, in „Blind Navigation“, mit Peilkompass und einem zuvor ausgearbeiteten, von einem Baumeister aus Tirol an Bord ebenso liebevoll wie händisch gezeichneten Passage Plan, auf dem freilich auch die wesentlichen Wegpunkte und Leuchtfeuer stehen. Nur, wie findet man die, wenn man plötzlich ausweichen muss und also vom Kurs abkommt oder die unbewohnte Insel am Wegesrand nur noch schemenhaft erkennt – „Ist das jetzt die Nordspitze?“ – und sich die roten und grünen Lateraltonnen einer Hafeneinfahrt am Ende in der Lichtverschmutzung am Horizont verlieren? Und wie kommt man zu dem brav am Funkgerät ausgehandelten Liegeplatz B12 auf Fuerteventura, wenn man trotz Suchscheinwerfer keinen Ponton findet, auf dem auch derlei Buchstaben stünden?

Mein letzter Tag auf der Insel wird ein echter herrlicher Segeltag sein, bei bis zu 20 Knoten und zwei bis drei Metern Welle kreuzen wir 24 Seemeilen gegenan, den begehrten Schein hab ich da aber schon in der Tasche, das „Debriefing“ war gestern – meine Selbsteinschätzung in den Kategorien „Course to Steer“, „Sail Handling“, „Communication“, „Rope Handling“, „Boat Handling“, „Pilotage“ und „Lights & Shapes“ fällt durchwegs kritischer aus als jene des Trainers, der wiederum und völlig zurecht durchweg Lob erntet von der Crew, für seine Arbeit. In „Pilotage“ reicht es sogar zur Maximalnote, bei „Boat Handling“ verzichtet Bernhard indes freundlicherweise auf eine Note, statt dessen gibt es einen Pfeil nach oben. Immerhin. Ich solle netter zu mir sein, hatte er schon in der ersten Woche gesagt und meine Freundin hatte ihm sofort recht gegeben.
Stolz wird sich erst zuhause einstellen.

Und jetzt? Clemens empfiehlt mir sogleich, „möglichst schnell“ in die Verantwortung als Skipper zu gehen – und auf meinem Einwand hin, dass ja Verantwortung, Erfahrung und Kompetenz in einem guten Verhältnis zueinander stehen sollten, also jenseits meines Kleinkreuzerchens vielleicht der Posten des Co-Skippers in bekannteren Gewässern erstmal besser sei, meinte er: „Vielleicht. Aber ich denke, es macht echt Sinn, eine kleine Yacht (32“) möglichst schnell eigenständig zu skippern. Ich würd das echt empfehlen“.
So soll es sein.

.




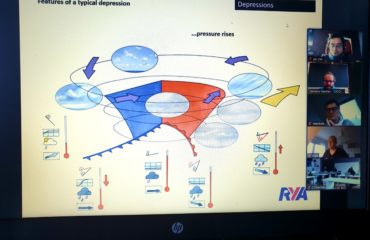

Super geschrieben, Jan.
Beim Lesen deiner Zeilen spürt man die Schaukelei vor Anker am eigenen Leib.
Dank dir!
Toller Bericht!Herzlichen Glückwunsch!